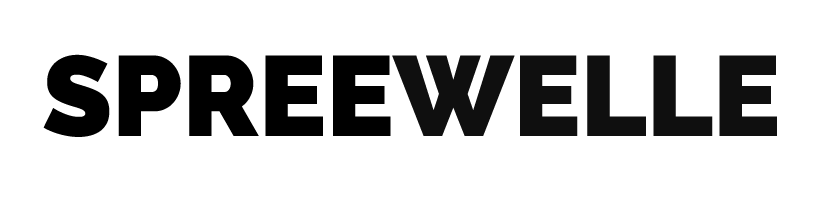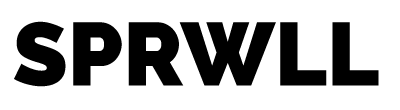Nach dem unglaublich langweiligen „Intensive Care“ veröffentlicht Robbie Williams mit der prall gefüllten „Rudebox“ ein Album, das endlich alles das hält, was man sich verspricht, wenn man einen neuen Robbie Williams erwartet.
„To The Rudebox, Shake Your Rudebox“ blubbert es aus den Lautsprechern. Die neue Robbie Williams Single also, aha. Klingt anders. Klingt aber auch ein bißchen nach Justin Timberlakes „Sexy Back“. Doch, lasst erstmal den Refrain spielen. Ah, ein wenig Melodie, keine schlechte dabei, und jetzt klingt es ein bißchen wie Jamiroquai. Aha. Dann in die zweite Strophe. Robbie Williams macht Sprechgesang, ein wenig weniger ironisch als auf „Rock DJ“. Aha.
Die Single macht genau das, was das ganze Album macht: Es irritiert. Wer vor einem Jahr Williams vorwarf, zuviel Aufsehens über seinen angeblich neuen Stil zu machen, der kann das bei diesem Album nicht mehr aufrecht halten. Denn egal, was man von den neuen Kompositionen auf „Rudebox“ halten mag, es ist deutlich anders, deutlich vielseitiger, deutlich weniger Robbie Williams. Und das tat auch mal dringend nötig.
Vor allem die Vielseitigkeit tut gut. Gleich nach dem Titeltrack erklingt ein Banjo-dominiertes Blues Stück namens „Viva Life On Mars“, das noch am ehesten an die Chambers-Ära erinnert, um gleich danach mit „Lovelight“ ein jamiroquaieskes Lews Taylor-Cover feilzubieten. Jamiroquai? In 2006? Ja, ja. Es ist erlaubt. Nämlich dann, wenn mit „King Of The Bongo“ direkt im Anschluss eine Covernummer in einem Sound erklingt, der so mega-80s klingt, dass einem ganz schummerig wird. Warum? Weil bei all der Unterschiedlichkeit ein roter Faden sichtbar wird. Und der zeichnet sich eben dadurch aus, das Grenzen geöffnet werden und Don’ts schlicht zu Do’s umformuliert werden. Das funktioniert, weil Williams auf Rudebox mit diesem Credo konstistent bleibt und oben drauf es tatsächlich schafft, richtig gute Songs zu schreiben. Denn auf „Rudebox“ gibt es das, was „Intensive Care“ gänzlich vermissen ließ: Hits.
Die sind zwar ein wenig versteckt, weil sie sich fremd kleiden – in neuen Sounds und neuen Strukturen – doch am Ende des Tages bleiben sie Hits. Da wäre das sonderbar klebrig-schöne „She’s Madonna“. Das Make Up der Pet Shop Boys klingt hier aus jeder Phase, fügt sich aber hervorragend mit Williams Stimme zusammen – in diesem Korsett fallen auch die Flipper-Drum-Breaks am Ende der Refrains nicht negativ aus, weil sie kein Fremdkörper sind. Unglaublich 90s-funky – und damit schon fast Old-School klingt „Good Doctor“. Williams klingt hier – wie auch an einigen anderen Stellen – nach… ja, nach „“ Mit „Louise“ ertönt dann eine betörende Midtempo-Ballade, die sich ein leichtes Elektrosommerkleid übergestreift hat, „Were The Pet Shop Boys“ treibt sich in ebenfalls elektronischem Nebel herum und mit „Kiss Me“ gehts dann auf den Rummel, besser zum Autoscooter. Billig-vibrierende Technosounds und ein hall-verstärkter Robbie Williams. Das geht an die Grenzen des guten Geschmakcs eigentlich. Aber durch diese bunte, quciklebendige Zusammenstellung lässt sich diese Disko-Rumkugel leicht verdauen.
Am meisten geredet wurde über die beiden therapeutischen Tracks „The 80s“ und „The 90s“. Der Boybandborn Williams hat ein großes Mitteilungsbedürfnis und hält sich demnach auch nicht damit auf, in Liedform zu dichten. Die Strophen reist er mit diesem gewöhnungsbedürftigen Sprechgesang ab. Aber untermalt werden die beiden Tracks von wunderschönen Musikbetten, so dass sie tatsächlich ein wenig nach Song klingen.
Was bleibt ist die Feststellung, dass sich bei Robbie Williams etwas getan hat. Das komplette Album ist hervorragend produziert, die Zusammenstellung mit 18 Tracks (!), die Kruez- und Querfahrt durch Musikgenres verleiht der Platte aber ein Gefühl des Rohen, den Schnellen, des Spontanen. Und genau das gab es bislang nicht bei den lupenreinen Dennis Chambers Alben.
Soviel ist klar: Wenn man in vielen Jahren über die Robbie Williams Karriere spricht, wird „Rudebox“ immer als einer der wichtigsten Meilenstein gelten.
(8/10)